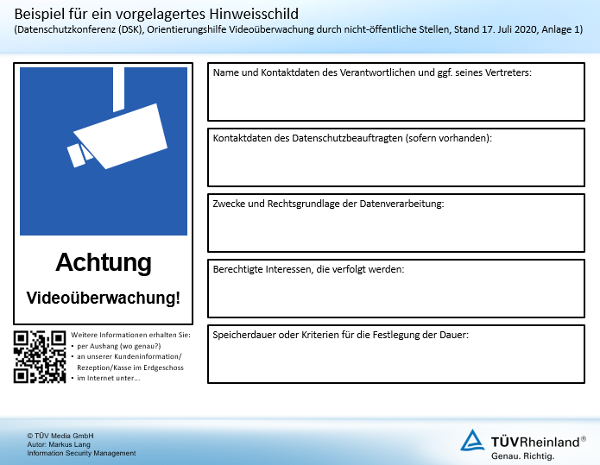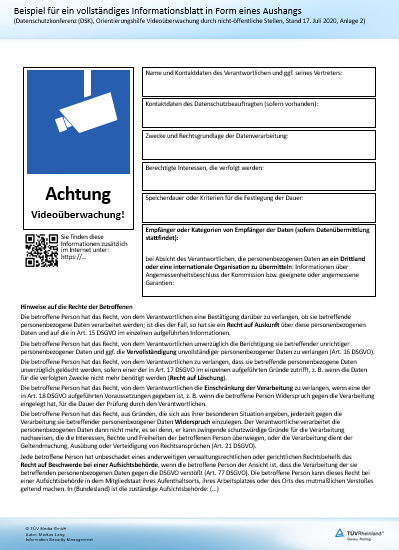07330 Videoüberwachung – Datenschutzrechtliche Zulässigkeit und Pflichten
|
Der Einsatz von Videoüberwachung wird häufig von Rechtsunsicherheit begleitet. Der zweiteilige Beitrag zur Videoüberwachung durch Private bietet Anwendern von Videoüberwachungstechnik eine Hilfestellung für eine rechtskonforme Umsetzung. Er beantwortet die wichtigsten Fragen zu einem rechtmäßigen Einsatz von Videoüberwachung durch Private. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen erläutert, verschiedene Einsatzszenarien bewertet und anhand von Beispielen Gestaltungsmöglichkeiten für die Praxis aufgezeigt. Dabei wird auch die Frage der rechtmäßigen Verwendung von Aufzeichnungen einer Videoüberwachung aufgegriffen und in dem hier relevanten Kontext beantwortet. Der Schwerpunkt dieses ersten Teils liegt auf der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit und den datenschutzgesetzlichen Pflichten beim Einsatz von Videoüberwachungstechnik. Arbeitshilfen: von: |
1.1 Ausgangspunkt
Private Videoüberwachung ist weit verbreitet. Eine visuelle und akustische Überwachung lässt sich mit handelsüblicher Technik ohne großen finanziellen und organisatorischen Aufwand realisieren. Damit Videoüberwachung als Mittel zur Sicherung und Kontrolle sinnvoll und erfolgreich eingesetzt werden kann, bedarf es jedoch einer sorgfältigen Planung (dazu s. Kap. 06271). Im Rahmen dieser Planung, aber auch der Einführung und des Einsatzes einer Videoüberwachung sind neben den technischen und organisatorischen Aspekten vor allem rechtliche Punkte zu berücksichtigen.
Risiko
Werden die rechtlichen Vorgaben und Anforderungen nicht beachtet, drohen nicht nur Maßnahmen von Datenschutzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden in Form von Untersuchungen bzw. Ermittlungen und Abhilfemaßnahmen wie Verboten. Rechtsverstöße können auch zivilrechtliche und bei einer Überwachung von Beschäftigten sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Schließlich besteht die Gefahr, dass die finanziellen Aufwendungen für eine Videoüberwachung zu einer Fehlinvestition werden. Weitere finanzielle Einbußen können aufgrund von Bußgeld, Geldstrafe, Schadenersatz und Kosten eines Rechtsstreits entstehen.
Werden die rechtlichen Vorgaben und Anforderungen nicht beachtet, drohen nicht nur Maßnahmen von Datenschutzaufsichts- und Strafverfolgungsbehörden in Form von Untersuchungen bzw. Ermittlungen und Abhilfemaßnahmen wie Verboten. Rechtsverstöße können auch zivilrechtliche und bei einer Überwachung von Beschäftigten sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Schließlich besteht die Gefahr, dass die finanziellen Aufwendungen für eine Videoüberwachung zu einer Fehlinvestition werden. Weitere finanzielle Einbußen können aufgrund von Bußgeld, Geldstrafe, Schadenersatz und Kosten eines Rechtsstreits entstehen.
Hinweis
Die in diesem Beitrag enthaltenen rechtlichen Bewertungen diverser Einsatzszenarien, exemplarischer Fallgruppen und Beispiele können die notwendige rechtliche Prüfung im Einzelfall nicht ersetzen.
Die in diesem Beitrag enthaltenen rechtlichen Bewertungen diverser Einsatzszenarien, exemplarischer Fallgruppen und Beispiele können die notwendige rechtliche Prüfung im Einzelfall nicht ersetzen.